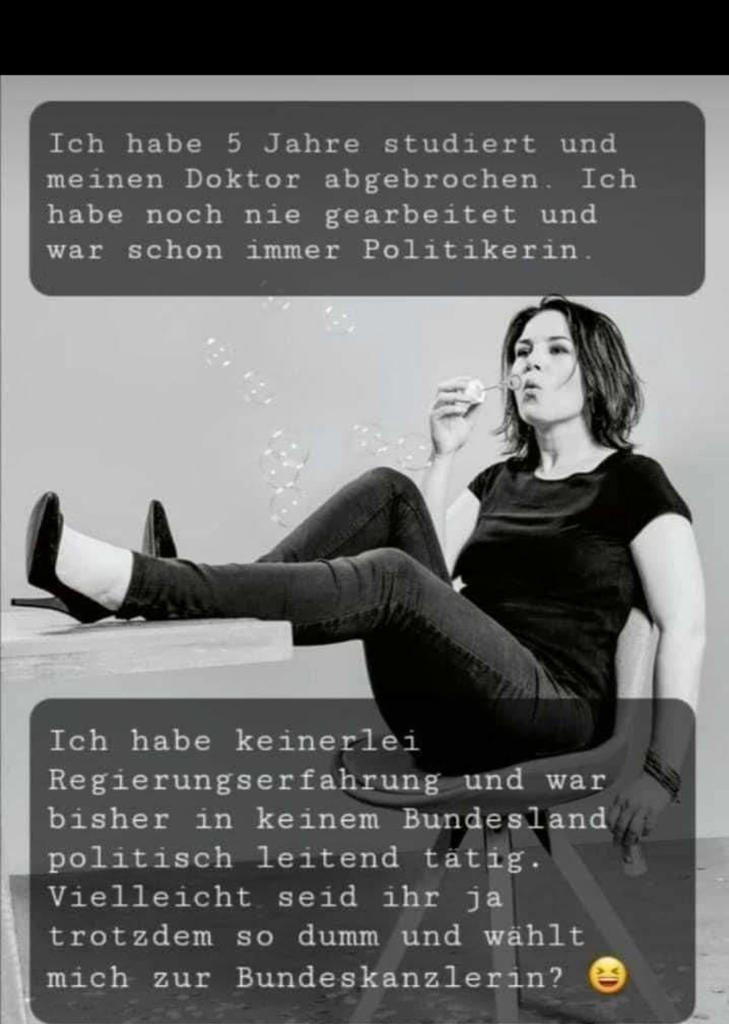Alle reden von Diversität. Doch in der Debatte über Identitäten gibt es zahlreiche blinde Flecken. Einer aber ist entlarvend.
Wer eine krisenfeste Stelle sucht, geht ins «Diversity-Management». Das ist gefragt, alle machen mit. Zum Beispiel die deutsche Filmgesellschaft Ufa, die sich jüngst als, wie sie betont, «erstes deutsches Unterhaltungsunternehmen» zu mehr Vielfalt verpflichtet hat: Es solle vor und hinter der Kamera künftig besser auf den Einbezug von LGBTIQ+, People of Color, Menschen mit Beeinträchtigungen und Gender geachtet werden. Auch Migrationshintergründe würden berücksichtigt. Sympathisch von der Ufa.
Höchstens könnte man einwenden, was denn mit den Juden sei. Gehörten sie nicht auch in den «Ufa Diversity Circle»? Immerhin, es ist die Ufa: ein Unternehmen, das sich 1933 in vorauseilendem Gehorsam aller jüdischen Mitarbeiter entledigt hat und dann unter Goebbels gross herausgekommen ist.
Man stehe für jeden ein, der Diskriminierung zu fürchten habe. Das sagte 2019 auf einem Parteitag der britischen Labour Party deren Diversity-Beauftragte Dawn Butler. Es mache, betonte sie, keinen Unterschied, ob jemand in einer Sozialwohnung lebe, LGBT+ sei oder heterosexuell; ob die Person einen Hijab trage, einen Turban oder ein Kreuz, ob sie schwarz sei, weiss oder asiatisch, ob sie an einer Beeinträchtigung leide oder in Oxbridge studiert habe oder zur Arbeiterklasse gehöre. Die Diversity-Beauftragte war sorgsam darauf bedacht, alle irgend möglich Marginalisierten mit einzubeziehen. Nur eine Gruppe ging, seltsamerweise, vergessen.
Juden, stellt man fest, sind selten mitgemeint, wenn die Sprache auf die Diversität kommt. Identitätspolitik scheint nicht für sie gedacht. Aber warum eigentlich nicht? weiter
Gefällt mir Wird geladen …